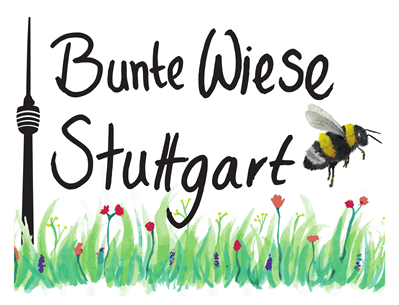Die Skorpionsfliege Panorpa vulgaris
Völlerei im Liebeskarussel
Wer denkt, das Aufregendste an Skorpionsfliegen sei der vermeintliche Stachel, irrt gewaltig:
Ihr Liebesleben macht sie zu Modellorganismen der Verhaltensökologie.
Skorpionsfliegen (Panorpidae) gehören zur Gruppe der Schnabelfliegen (Mecoptera), die durch ihre schnabelartig verlängerten Köpfe auffallen (Abb. 1). Die Skorpionsfliegenmännchen besitzen am Ende ihres aufwärts gebogenen Hinterleibs zudem eine Verdickung, die an den Hinterleibsstachel der namengebenden Gliederfüßer erinnert (Abb. 2). Es ist aber keine Waffe, sondern eine Art Zange: Damit greifen sie bei der Paarung von unten den Hinterleib des Weibchens, das sich dabei V-förmig versetzt über ihnen befindet.
Was sie für die Forschung so interessant macht, ist, dass die Dauer der Kopulation davon abhängt, wie lange das Männchen es schafft, das Weibchen (Abb. 3) während des Aktes mit Nahrung zu versorgen. Davon hängt nämlich ab, wie viele Spermien übertragen werden können. Da speziell die Art Panorpa vulgaris als „hochpromiskuitiv“ gilt, also ein Weibchen sich mit vielen Männchen verpaart, ist es wichtig, mehr Spermien zu übertragen als die Konkurrenz. Für das Weibchen wiederum ist es ein Zeichen der Fitness ihres Partners, wenn er sie mit möglichst vielen Brautgeschenken versorgen kann. Sobald es nichts mehr zu fressen gibt, beginnt sie, unruhig zu werden und schüttelt den Partner ab – Zange hin oder her. Die Männchen haben sogar eine weitere Haltevorrichtung auf dem Rücken, das Notalorgan, mit dem sie den Außenrand eines Vorderflügels einklemmen, aber das Weibchen ist trotzdem in der Lage, den Akt zu unterbrechen, wenn es nicht mehr will.
Die Nahrung von Skorpionsfliegen besteht überwiegend aus Aas, insbesondere toten Insekten. Skorpionsfliegen klauen mitunter sogar Spinnen die Beute aus dem Netz. Mit ihren langen Köpfen stochern sie in den Kadavern rum und sondern dabei zersetzende Sekrete ab, die das Innere verflüssigen, um es dann aufzusaugen. Darüber hinaus besitzen Skorpionsfliegenmännchen aber spezielle Speicheldrüsen, mit denen sie eine milchige Flüssigkeit absondern können, aus der sie mit Ihren Mundwerkzeugen Kugeln formen, die an der Luft aushärten: Die sogenannten „Drops“ oder „Liebesbonbons“. Um sie bei der Sache zu halten, haben die Männchen die Möglichkeit, ihren Geschlechtspartnerinnen Aas zu präsentieren und / oder möglichst viele der Bonbons zu produzieren und abzulegen. Wird das Weibchen nach einigen Minuten unruhig, dreht das Männchen sich mit ihr um 60%, damit sie das neue Bonbon auf der Unterlage entdeckt. So drehen sie sich im Kreis, bis er nicht mehr kann oder sie nicht mehr will. (Ein bis zwei Stunden kann das so gehen.)
Es konnte nachgewiesen werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Menge verspeister Drops und der Menge gelegter Eier besteht. Die Menge der Drops, die ein Männchen produzieren kann, hängt wiederum damit zusammen, wieviel Nahrung er sich zuvor selbst beschaffen konnte: Aas ist eine begrenzte Ressource und Skorpionsfliegen kämpfen untereinander um gefundene Nahrung. Auch die Fruchtbarkeit der Weibchen hängt davon ab, wie erfolgreich sie die ökologischen Ressourcen ihrer Umwelt ausnutzen.
Unsere fünf heimischen Panorpa-Arten sind deshalb so gut erforscht, weil an ihnen die Wechselwirkungen zwischen Verhalten und Umweltfaktoren untersucht werden können, und, welche evolutionären Konsequenzen diese haben. P. vulgaris hat z.B. eine Schwesterart, P. communis, die im selben Lebensraum vorkommt. Die beiden zum Verwechseln ähnlichen Arten präferieren aber unterschiedliche Mikrohabitate und zeigen deutliche Unterschiede im Paarungsverhalten: P. communis-Weibchen verpaarten sich unter Laborbedingungen im Schnitt 7 bis 8, anstatt 25 mal. P. germanica-Weibchen begnügen sich teilweise mit nur einem Männchen und bei der Partnerwahl spielen Pheromone (Sexuallockstoffe). So viel sei noch verraten: Das Liebesleben der Skorpionsfliegen birgt viele weitere juicy details.
Verfasserin: S. Lanckowsky
Literatur zum direkt Nachlesen
- Aumann, Nicole (2000): Lebenslaufgeschichte und Paarungssystem der Skorpionsfliege
- Panorpa communis L. (Mecoptera, Insecta), Dissertation vorgelegt an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/1656
- Grzimek, Bernhard (Hrsg.) (1979): Grzimeks Tierleben, Bd. 2 Insekten, S. 300 – 303, dtv, München
- Nuß, Mathias (2021): Gemeine Großpunkt-Skorpionsfliege, https://www.insekten-sachsen.de/Pages/TaxonomyBrowser.aspx?id=223744, abgerufen am 28.09.2025
- Wikipedia DE: Skorpionsfliegen, https://de.wikipedia.org/wiki/Skorpionsfliegen (abgerufen am 28.09.2025)
- EcolVersity auf Youtube (2022): Kennarten Video Skorpionsfliege, Ruhr Universität Bochum, https://www.youtube.com/watch?v=JoL66U4l5uU