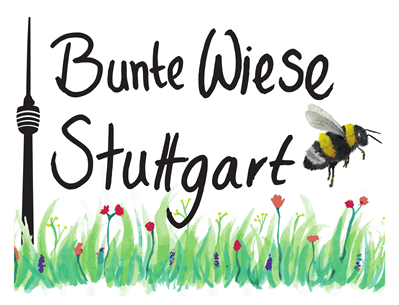Fliegende Goldstücke
Die Dichtpunktierte Goldfurchenbiene
(Halictus subauratus)
Dichtpunktierte Goldfurchenbiene, das ist ein ziemlich langer Name für eine 7-8 mm kleine Wildbiene, beschreibt sie aber ebenso wie ihr wissenschaftlicher Name Halictus subauratus ziemlich treffend (Abb. 1). Mit etwa 7-8 mm Körperlänge ist sie in etwa halb so groß wie eine Honigbiene (Abb. 2), aber auch mit bloßem Auge kann man bei genauem Hinsehen den grün-goldenen bis grün-bronzefarbenen Glanz des Körpers erkennen. Die dichte Behaarung ist gelb und die Komplexaugen grün. Die Endränder der Hinterleibssegmente tragen eine Binde aus creme-gelben Filzhaaren und auf dem letzten Hinterleibssegment ist bei den Weibchen zudem eine haarlose senkrecht stehende Furche zu erkennen, die alle Furchenbienen-Weibchen besitzen. Die Männchen ähneln den Weibchen, doch die Fühler sind deutlich länger, der Körper etwas schmaler und langgestreckter und die Beine hellgelb gezeichnet. Die Dichtpunktierte Goldfurchenbiene ist allerdings nicht das einzige “fliegende Goldstück”, es gibt noch einige andere Goldfurchenbienen-Arten die anhand von Fotos oder mit bloßem Auge schwer zu unterscheiden sind.
 Abb. 1: Ein Weibchen der Dichtpunktierte Goldfurchenbiene beim Nektartrinken auf einer Schafgarbenblüte. Der Körper ist grün-gold bis grün-bronzefarben glänzend und dicht gelb behaart. Die großen Komplexaugen sind grün und die Hinterleibssegmente mit dichten creme-gelben filzigen Haarbinden bedeckt. Nur am Foto sind sie meist schwer von anderen Goldfurchenbienen-Arten zu unterscheiden. Foto: Sonia Bigalk
Abb. 1: Ein Weibchen der Dichtpunktierte Goldfurchenbiene beim Nektartrinken auf einer Schafgarbenblüte. Der Körper ist grün-gold bis grün-bronzefarben glänzend und dicht gelb behaart. Die großen Komplexaugen sind grün und die Hinterleibssegmente mit dichten creme-gelben filzigen Haarbinden bedeckt. Nur am Foto sind sie meist schwer von anderen Goldfurchenbienen-Arten zu unterscheiden. Foto: Sonia BigalkDie Dichtpunktierte Goldfurchenbiene ist in weiten Teilen Deutschlands verbreitet und bevorzugt warme Böschungen, Magerrasen, Sand- und Kiesgruben aber auch Ruderalstellen im Städtischen Raum. Die Weibchen graben ihre Nester in den Boden, bevorzugt an vegetationsarmen Stellen, Böschungen oder sogar Steilwände mit sand- oder lösshaltigen Stellen. Dabei graben sie einen 10-15 cm langen Hauptgang an den die Brutzellen anschließen. Die begatteten Weibchen überwintern und beginnen ab dem Frühjahr (April/Mai) alleine mit dem Nestbau. Im Juni schlüpfen dann 4-5 sogenannte Hilfsweibchen, Töchter die sich allerdings nicht verpaaren sondern nur bei der Versorgung des Nests helfen. Ab Juli schlüpfen männliche und weibliche Nachkommen, die sich dann verpaaren. Die Männchen und Hilfsweibchen überleben den Winter nicht, nur die Begatteten Weibchen gründen im nächsten Frühjahr ein neues Nest. Diese Lebensweise wird als primitiv eusozial bezeichnet.
Die flugfähigen ausgewachsenen Goldfurchenbienen ernähren sich von Nektar verschiedener Pflanzen. Für die Versorgung des Nachwuchses sammeln sie den eiweiß- und nährstoffreichen Pollen verschiedenster Pflanzen, weshalb sie als polylektisch bezeichnet werden, da sie nicht auf bestimmte Pflanzen spezialisiert sind. Der Pollen wird in den dichten Haaren der Hinterbeine gesammelt (Abb. 3) und zum Nest transportiert. Besucht werden zum Beispiel Wiesenschafgarbe, Wilde Möhre, Rainfarn, Wegwarte, Wiesenflockenblume, verschiedene Disteln oder auch Ackerwinden. Im Gegensatz zu vielen anderen Wildbienenarten nehmen sowohl die Verbreitung als auch die Bestände der Dichtpunktierten Goldfurchenbiene zu (abb. 4), dennoch ist auch sie auf ein großes Angebot an blühenden heimischen Wildpflanzen und ausreichend Nistmöglichkeiten angewiesen.
Verfasserin: S.Bigalk
Literatur zum direkt Nachlesen
- Westrich, P. (2019): Die Wildbienen Deutschlands, 2. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart.
- Scheuchl, E., Schwenninger, H.R., Burger, R., Diestelhorst, O., Kuhlmann, M., Saure, C., Schmid-Egger, C. Silló, N. (2023): Die Wildbienenarten Deutschlands – Kritisches Verzeichnis und aktualisierte Checkliste der Wildbienen Deutschlands (Hymenoptera, Anthophila). Anthophila (1)
- Webseite des "Kompetenzzentrum Wildbienen", Unterseite Anthophila (Weblink)
- Schwenninger, H.R., Haider, M., Prosi, R., Herrmann, M., Klemm, M., Mauss, V. & Schanowski, A. (2025): Rote Lister und Verzeichnis der Wildbienen Baden-Württembergs. Naturschutz-Praxis Artenschutz 4, LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe.
- Webseite der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Unterseite der Rote Liste und dem Verzeichnis der Wildbienen Baden-Württembergs (Weblink)